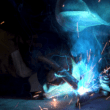Stell dir vor, du lebst am Existenzminimum. In deiner Hosentasche befinden sich gerade mal ein paar Euro für ein Brötchen. So etwas wie ein Zuhause kennst du nicht, da dein Schlafplatz sich täglich ändern kann. Das ist für circa 45.000 Menschen in Deutschland die eiskalte Realität. Es zieht Obdachlose in die Großstädte, um sich etwas Geld zu erbetteln und Unterschlupf zu suchen. Doch die Städte wollen die Wohnungslosen nicht auf ihren Straßen haben. Es sei gerade in touristischen Gegenden rufschädigend und werfe ein schlechtes Licht auf die Stadt. Deshalb ergreifen sie Maßnahmen. Zu diesen gehören Bänke, die mit mehreren Armlehnen ausgestattet worden sind. Ist doch nett, oder? Das macht diese Bänke aus hartem Stahl doch gleich viel bequemer. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Die Sitze sollen nur zum kurzen Verweilen einladen – auf Dauer werden sie ungemütlich. Gerade das Liegen soll hier komplett unterbunden werden. Denn die Wohnungslosen könnten diese Bänke als Schlafmöglichkeit wahrnehmen.

Für Obdachlose bedeutet das: Hier können sie nicht bleiben. Nein, sie sind regelrecht unerwünscht. Es wird nach dem Motto gehandelt: „Setz dich ruhig hin, aber bleib bloß nicht zu lange.“ Das ist dir noch nie aufgefallen? Genau das ist das Ziel – Obdachlose zu vertreiben und sich dabei schön aus dem Staub machen. Es wird sich hinter schamlosen Aussagen versteckt, um nicht als der Übeltäter dargestellt zu werden. Es sei komfortabler und außerdem seien Stahlbänke viel einfacher zu reinigen, heißt es dann als Erklärung. Es gibt Städte, die unter Brücken Steine platzieren, damit Obdachlose dort kein Nachtlager aufschlagen können. Nicht einmal dort dürfen sie sich zurückziehen. Es gibt Pilotprojekte, in denen klassische Musik nachts an Bahnhöfen läuft – und das mit demselben Lied in Dauerschleife. Klar, dass man es nicht erträgt, sich dort für längere Zeit aufzuhalten. Selbst Geschäfte und Bürger ziehen bei den Maßnahmen mit. Bevor sich jemand in der Nacht einfach vor ihre Haustür oder ihr Schaufenster legen kann, ist der Bereich mit Stacheln oder Barrieren versehen. Sicher ist sicher.
All diese Maßnahmen fallen erst auf den zweiten Blick auf. Wenn es nach den Städten geht, sollen diese am liebsten gar nicht von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Je unauffälliger, desto besser ist die Devise. Die Mittel sind so subtil, dass es nicht genügend Protest dagegen gibt. Es fällt den Menschen schlichtweg gar nicht mehr auf, weil diese Bebauungen zum Alltag geworden sind. Und das bescheuerte an der Sache: Für sowas wird absurd viel Geld ausgegeben. Warum steckt man das Geld nicht in Hilfsprojekte oder Notunterkünfte? Städte denken das Problem sei damit unter den Tisch gekehrt. Und das ist das Problem! Wo ist diese Toleranz gegenüber allen Menschen, die spätestens jetzt in den Köpfen der Menschen angekommen sein sollte? Obdachlose – die Verstoßenen der Gesellschaft.