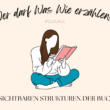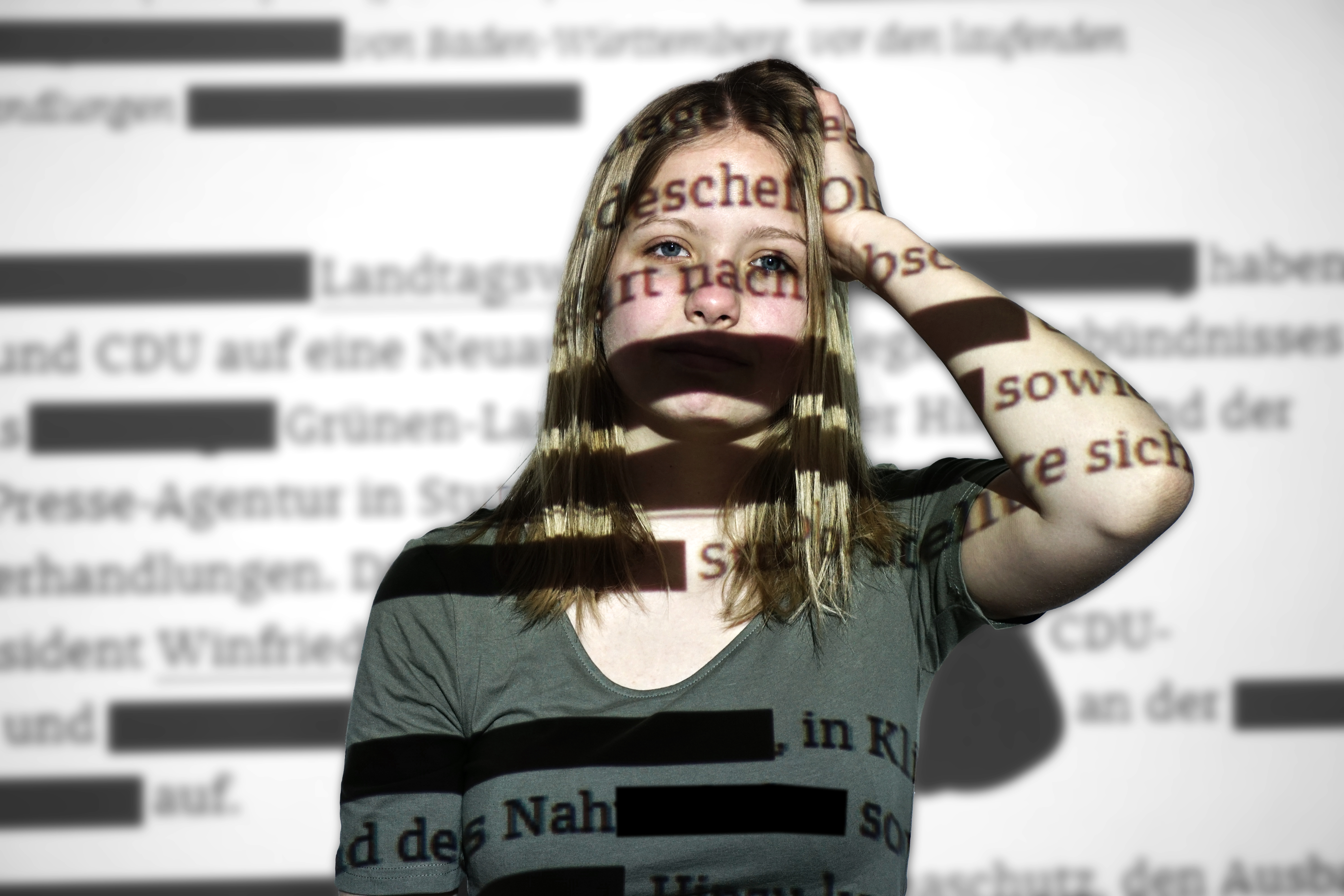In der Schule werden Diktate geschrieben. Anschließend korrigieren Lehrende Fehler der Schreibweise und Zeichensetzung. Doch was ist, wenn es um Meinung und Haltung geht? Hier gibt es kein richtig und falsch, nachvollziehbar muss es sein. So die typischen Lehrerworte. In aktuellen Mediendebatten geht es nicht um Grammatik, wohl aber auch um die richtige Ausdrucksweise – politisch korrekt muss sie sein. Fehler werden nicht mit einer schlechten Note, sie werden mit Shitstorms geahndet. Häufig hilft dann auch die gute Inhaltsabsicht nicht aus der Patsche heraus. Den erzieherischen Prozess in orthografischen Korrekturen auf den politisch korrekten Ausdruck zu übertragen, birgt Gefahren. Wenn das Publikum auf Fehlersuche unsagbarer Wörter geht und Medieninhalte abstempelt, bevor es den Blick auf die sachlichen Argumente wirft, dann hat es als Gedankenpolizei eine gefährliche Machtposition eingenommen.
Doch woher kommt der schulhafte Korrektheitszwang in der Sprache? Die Ursache liegt in der zunehmenden Bewusstwerdung für strukturellen Rassismus. Die weltweite Unruhe um den Tod von George Floyd, aktuelle Debatten um die Einführung einer Frauenquote und viele weitere aktuelle Anlässe zeigen, Identitäten prägen Machtverhältnisse noch heute. So wird unterschieden zwischen schwarz/weiß, Mann/Frau, Staatsbürger/Ausländer, heterosexuell/homosexuell. Die Hälfte der Befragten einer im Juni 2020 durchgeführten YouGov-Umfrage hält Rassismus in den sozialen Medien und auf Job- und Wohnungssuche für ein (sehr) großes Problem in Deutschland. Zur Abwendung von dem derartigen Rechtsruck entsteht Linksdruck. Er entspringt in den 1970ern einer universitären Antirassismus-Bewegung orthodoxer Linker in den USA. Rund 20 Jahre später sind Verfechter der politischen Korrektheit auch in Deutschland präsent und bekunden fortlaufend Sprachreglementierungen. Vor allem Medienschaffende wie JournalistInnen sind gefordert.
Einzelfallentscheidungen in der Medienpraxis
„Politische Korrektheit mitzudenken, ist kein Hemmnis, sondern ein sinnvolles Instrument, um sich und seine Arbeit an die Gegenwart anzugleichen“, meint Imre Grimm, Journalist und Leiter des Gesellschaftsressorts beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seine berufliche Rolle erfordere Rücksichtnahme auf gesellschaftliche Befindlichkeiten und auf Erfordernisse moderner Kommunikation. Dennoch, im Arbeitsalltag ließen sich Grenzen definieren, es handle sich um Einzelfallentscheidungen, führt der Journalist aus. Eine Einzelfallentscheidung erfordert unter anderem die Genderdebatte: Gendersternchen, Gender-Gap Doppelpunkt, beide Geschlechterformen verwenden oder komplett auf das Gendern verzichten – es gibt keine mediale Einheitlichkeit. Durch gendergerechte Sprache werde die Forderung der Gleichberechtigung in der Sprache ernstgenommen, positionieren sich Gabriele Diewald und Anja Steinhauer, Autorinnen des „Richtig Gendern“-Dudens. Zweifelsohne prägt Sprache das Denken mit. Neben dem gestörten Lesefluss betont Imre Grimm jedoch die Gefahr, dass die Durchdringung tieferliegender Ursachen von Machtgefällen geringer werde, „wenn man nur auf den Text starrt und Anzeichen dafür sucht, dass sich jemand nicht an die politisch korrekte Genderisierung hält.“
Ein Höhepunkt der Genderdebatten zeigt sich in einem aktuell laufenden Gerichtsverfahren gegen den Audi-Gender-Leitfaden. Die Personalchefin des Autokonzerns Sabine Maaßen stellte mit Etablierung der Unternehmensrichtlinien Anfang März klar, dass gendersensible Sprache eine Frage des Respekts und Ausdruck einer Haltung gegen Diskriminierung und für Vielfalt sei. Der Vorwurf, dass nicht zu Gendern diskriminierend sei, ist bekannt. Die Klage eines VW-Mitarbeiters dreht den Diskriminierungsvorwurf um. Seine Anwälte Burkhard Benecken und Dirk Giesen erklären: „Das Weglassen spezifischer männlicher Endungen” sei nicht von Vorteil, sondern gestalte sich „als fortgesetzte Diskriminierung”. Ist das Gendern also eine nötige Sprachanpassung unserer Zeit? Das Klagebeispiel zeigt, wie unterschiedlich und verbissen sich Betroffene positionieren.
Neben der Genderdebatte entstehen viele weitere Kernthemen rund um politische Korrektheit, die den medialen Berufsalltag prägen. Besonders der Tagesschau mit durchschnittlich über 11 Millionen Fernsehzuschauenden (Stand 2020) wird qualitativ viel abverlangt. Aus tausenden Publikumsreaktionen am Tag gehe hervor: unzutreffende Formulierungen sowie unterrepräsentierte Themen und Meinungen würden häufig als unterdrückend oder diskriminierend wahrgenommen werden, beschreibt Burkhard Nagel. In seiner Position als Tagesschau-Qualitätsmanager liefere er den Redaktionen diesbezügliche Denkanstöße. Als Beispiel nennt er die Bezeichnung der Russland-Ukraine-Auseinandersetzung. Krieg oder Konflikt? Eine einzelne Formulierung habe vor zwei Jahren zu einer Reihe von internen und externen Diskussionen geführt: „Kriegerische Auseinandersetzung“ sei zwar ein sprachliches Ungetüm, aber eine politisch korrekte Lösung gewesen.
Schützengräben der eigenen Meinung
Die Sorge um die Meinungsfreiheit unter Medienschaffenden wird lauter. Dabei ist diese in Deutschland ein hohes Gut. Grundgesetzlich verankert habe jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Doch auch Burkhard Nagel bereiten aktuelle Entwicklungen Sorge. Er hebt die Rolle attackierter ReporterInnen hervor, die nicht wie er selbst im „sicheren Nest“ der Schlussredaktion sitzen. Laut Angaben des kriminalpolizeilichen Meldedienstes haben sich die Straftaten gegen Medien im Jahr 2020 von 104 im Vorjahr auf 252 mehr als verdoppelt.
Insbesondere junge Links-Identitäre seien dabei die „Kulturpolizei“ der Gesellschaft, so Journalistin und Schriftstellerin Caroline Fourest in ihrer, im Oktober 2020 veröffentlichten Kritik „Generation beleidigt“. Neben physischen Übergriffen werden besonders im Netz schockierte Minderheiten größer und lauter. „Bei dem geringsten Stich in unsere Haut, und sei er noch so mikroskopisch klein, heulen wir mit einem Griff in die Tastatur auf“, verdeutlicht Caroline Fourest. Wir würden uns in Schützengräben der eigenen Meinung verschanzen und seien auf dem Weg, die „irrsinnig wichtige Kulturtechnik“ des Zuhörens zu verlernen, bekräftigt Imre Grimm und führt aus: „Die Gesellschaft ist momentan sehr auf Sendung und wenig auf Empfang.“ Sie tendiere dazu, die Semantik des Textes zu sezieren, anstatt sich mit Inhalten auseinanderzusetzen – Intentionen, Interessen und Quellen zu hinterfragen. Doch auch das muss bedacht werden, das digitale Zeitalter und die unüberschaubar große Vielfalt an Wahrheiten und Gegenwahrheiten erfordern eine hohe Medienkompetenz. Der Tagesschau-Qualitätsmanager Burkhard Nagel macht darauf aufmerksam, dass RezipientInnen tendenziell die Inhalte glauben würden, die am besten in ihr eigenes Weltbild passen, anstatt sich der faktischen Verifizierung zu widmen. Durch diese Sichtweise käme es zunehmend zu kritisierenden Reaktionen und Beschimpfungen.
Das Publikum als Druckinstanz
Nicht der Staat, sondern einzelne Publikumsgruppen entwickeln sich zu einer Druckinstanz. Dabei stehen Medienpersonen in Ihrem Tun unter genauster Beobachtung. Sie sollen Zeichen setzen und Haltung zeigen, aber politisch korrekt bleiben. Ausnahmslos. Ansonsten grüßt die Shitstormwelle – das zeigen zahlreiche Beispiele der jüngsten Vergangenheit:
Im Fall des WDRs führt eine fragwürdige Expertenzusammensetzung zurecht zu erhitzten Gemütern. Sind Fehler nicht aber menschlich und verzeihbar? Wie viel Inszenierung tut der Debatte gut? Zunehmend ziehen unbedachte Wörter und Formulierungen Konsequenzen nach sich, wenn sie als diskriminierend aufgefasst werden. Shitstormwellen setzen Medienpersonen und -institutionen unter Druck. Ein Erklärungsversuch wäre aufwendig, eine Verharmlosung fatal. Im Zweifel lieber entschuldigen, scheint immer häufiger die Devise.
Zweifelsohne war die Talkrundendebatte über rassistisch konnotierte Begriffe wie „Zigeunerschnitzel“ einer im Januar 2021 erschienenen Folge der WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ sehr einseitig. So diskutierten lediglich weiße Gäste und erklärten das Konfliktpotenzial solcher Ausdrücke einstimmig für überzogen. Die WDR-Unterhaltungschefin Katrin Kuhne entschuldigte sich öffentlich für die unpassende Gästezusammenstellung bei solch ernster Thematik und räumt ein, in diesem Fall sei der Diskussionsverlauf unglücklich gelaufen, das hätte der WDR „besser machen können.“
Neben psychischen kommt es zudem vermehrt auch zu beruflichen Konsequenzen. Durch den Öffentlichkeitsdruck stoßen Medienanschaffende also an die Grenzen des Sagbaren: JournalistInnen sollen kritisch, aber fehlerlos berichten. SatirikerInnen sollen nahbar, aber nicht zu satirisch sein. Werbung soll an bewegenden Themen der Zeit anknüpfen, aber nicht zu plakativ gestaltet werden. Kunst soll frei, aber angemessen sein. Der Irrsinn schaukelt sich hoch und geht so weit, dass die Übersetzerin einer schwarzen Lyrikerin nicht weiß sein und ein Mann keine Frauenprobleme betiteln darf: „Wenn nur noch Angehörige einer bestimmten Gruppe das Recht haben sollen, über jene Gruppe zu disputieren, dann verengt sich automatisch die Debatte und das kann niemals das Ziel einer freien und offenen Gesellschaft sein“, warnt Imre Grimm. Wer darf wie worüber sprechen? In der ständigen Auseinandersetzung mit diskriminierten und nicht diskriminierten Teilgruppen entsteht ein gesellschaftliches Dilemma: gegen spaltende Diskriminierung vorgehen und dabei nicht im nächsten Spaltungsmechanismus verirren. Eine schwierige Aufgabe.
Das Gedicht „Hill we climb“ der 22-Jährigen afroamerikanischen Amanda Gorman wurde für die Amtseinführung von Joe Biden verfasst und seither international übersetzt. In den Niederlanden führte die Frage der passenden Übersetzerrolle zu einer großen Debatte. Trotz der Zustimmung von Amanda Gorman wurde Marieke Lucas Rijneveld aufgrund ihrer hellen Hautfarbe als unpassend disqualifiziert. „Ich bin schockiert von dem Aufruhr, der sich um meine Beteiligung an der Verbreitung von Amanda Gormans Gedicht entwickelt hat”, schrieb sie auf Twitter und lehnte schließlich die Einladung des Meulenhoff-Verlages ab.
Die gesellschaftliche Öffentlichkeit wacht über Medienschaffende und legt Geschehnisse auf die Waagschale. Als Rassist gilt nicht mehr bloß der, der rassistisch handelt, sondern auch jener, der durch seine Ausdrucksweise oder gar wegen seiner Identität den Verdacht erweckt. Die antidiskriminierenden Wertvorstellungen hinter politischen Korrektheits-Bestreben sind grundsätzlich wertvoll. Häufig ist die Publikumskritik bezüglich mangelnder Sprachsensibilität legitim. Und dennoch, demokratiefreundlich ist die aktuelle Methodik nicht. Durch die Macht von Worten und Formalitäten verblasst der Wert von Aussageintentionen und sachlicher Argumente. Die Gedankenpolizei und ihr Korrekturzwang disqualifizieren Inhalte vorschnell als unmoralisch und stellen Medienschaffende vor ein Tribunal: Im schlimmsten Fall werden sie mit Stockschlägen aus der Öffentlichkeit vertrieben. „Ob nicht das Leben die Sprache mehr prägt als die Sprache das Leben“, bezweifelt dabei der Journalist Imre Grimm.Sprache ist leicht erkennbar, Medienpersonen sind einfach zu kritisieren, doch lassen sich so die Sündenböcke gesellschaftlicher Diskriminierungsprobleme bekämpfen?
Auf eine Folge von Höhle der Löwen folgte ein Shitstorm. Die Produktidee der „Pinky Gloves“, Menstruation-Handschuhe zur Entsorgung von Binden oder Tampons erhielt so viel Kritik, dass das Gründerteam und Investor Ralf Dümmel den Marktrücktritt ankündigten. Der Spott bezog sich vor allem auf das männliche Geschlecht beider Geschäftsführer. Sie hätten ein natürliches Frauenproblem diskreditiert.